Evolution ist (k)ein heisses Eisen
Das ist keine wissenschaftliche Abhandlung und ich bin weder Biologe noch Evolutions-Spezialist! Hier geht es nicht um spezielle, wissenschaftliche Erkenntnisse, sondern um eine Übersicht zum aktuellen Stand des Wissens über die Evolution. Deswegen reicht es aus, wenn hier nur die im Internet frei verfügbaren Quellen zitiert werden. U.a. auch Artikel aus Wikipedia, die wissenschaftlichen Ansprüchen nicht immer genügen.
Für den eiligen Leser: Überblättern sie einfach alle ZITATE ...!
Mich interessieren ein paar interessante Fragen im Zusammenhang mit Evolution:
- Evolution ist auf das Leben ausgerichtet. Wo kommt das Leben her?
- Was ist und wie funktioniert biologische Evolution?
- Nach welchen Spielregeln entwickelt sich das Leben auf der Erde?
- Wie kommt es zu der sehr grossen Vielfalt des Lebens?
- Gibt es qualitative Sprünge in der Evolution?
- Ist Evolution ein Naturgesetz?
In der populärwissenschaftlichen Literatur wird Evolution sehr kontrovers diskutiert. Liest man unbedarft im Internet und in manchen "Sachbüchern", so kann man schnell zu der Überzeugung kommen, dass Evolution ein sehr umstrittenes Thema ist. Das liegt daran, dass u.a. christliche Fundamentalisten die Evolution leugnen und weiterhin darauf bestehen, dass Jesus die Erde in sechs Tagen erschaffen hat. Ich akzeptiere, dass solche Vorstellungen existieren, aber mein "gesunder Menschenverstand" entdeckt darin (im Gegensatz zur Evolution) zu viele Widersprüche. Ich gehe von der biologischen Evolution als von einer durch viele wissenschaftliche Beweise gesicherten Tatsache aus.
Ich lasse mich hier nicht auf den 150 Jahre alten Evolutions-Streit zwischen Wissenschaft und Glauben ein. Auch deshalb, weil er nicht zu schlichten ist. Kreationismus, Intelligent Design und der Schöpfungsglaube in den unterschiedlichsten Religionen interessieren hier nicht. Naturwissenschaft und Glaube sind unvereinbar. Glaube ist gegenüber rationalen Argumenten und wissenschaftlich anerkannten Beweisen immun. Ausserdem hat Till Biskup alle vernünftigen Argumente gegen die evangelikale Evolutionskritik bereits übersichtlich zusammengestellt: www.evolutionskritik.de ... Auch er hat keine Chance gegenüber Leuten, denen es weder um Wissenschaft noch um Wahrheit sondern nur darum geht, an ihrem 2000 Jahre alten, religiös geprägten Weltbild festzuhalten.
Evolution ist kein heisses Eisen, sondern ein hoch interessanter Wissenschaftsbereich. Wie überall in der Wissenschaft sind noch viele Fragen offen. Das ist normal. Gleichzeitig aber existieren solide wissenschaftliche Erkenntnisse über die Entwicklung des Lebens im Verlauf von rund vier Milliarden Jahren von Einzellern bis hin zu den Säugetieren: Evolution.
Chemische Evolution vor biologischer Evolution
Es existiert bisher keine befriedigende Antwort auf die Frage nach dem Ursprung des Lebens auf der Erde. Die chemische Evolution des Lebens - also der Sprung von unbelebter zu belebter Materie - ist wissenschaftlich bisher nicht belegt.
Trotzdem geht auch heute noch die populärste Theorie zur Entstehung des Lebens von einer chemischen Evolution aus. Es hat in den letzten 100 Jahren immer wieder Versuche gegeben, Leben chemisch zu erzeugen: Beispiel: Das Miller-Urey-Experiment. Dabei konnten maximal einfache organische Verbindungen erzeugt werden.
Für die Entstehung des Lebens muss aber mindestens ein RNA-Molekül synthetisiert werden, damit die Erbinformation gespeichert werden kann. RNA- oder DNA-Moleküle sind quasi die Speichermedien (Hardware) für das Genom. Woher aber kommt der Speicherinhalt, besteht aus der Gesamtheit der Informationen über das Lebewesen (Erbgut=Genom), das zu dieser DNA gehört (Software)?! Eine Hypothese geht davon aus, dass das Leben aus einer RNA-Welt hervorgegangen ist:
 |
Nur mit der "Erfindung" der DNA und des Genoms funktioniert immer noch kein Leben! Dazu ist noch die Zelle nötig, ohne die das Genom nicht überleben kann. Vor allen Dingen aber wird das Verfahren der Replikation der DNA gebraucht. Erst mit der Replikation werden Fortpflanzung, Vererbung und Evolution möglich:
 |
Die Entstehung der ersten Zellen ist unbekannt. Danach aber war der Beginn aller höheren Organisation gekennzeichnet durch die Kooperation von Mikroorganismen in einer Zelle! Wie aus primitiven Prokaryoten (ohne Zellkern, grün und blau) durch Evolution weitere und höher entwickelte Einzeller (mit Zellkern) entstanden sein können, ist nachvollziehbar, wie dieses Bild zeigt:
 |
Durch chemische Evolution müsste also (1.) das Genom synthetisiert und programmiert (!) werden (Hard- und Software). (2.) Es muss die Zelle mit Stoffwechsel (!) entstehen, ohne die das Genom nicht lebensfähig ist. Und (3.) muss das Verfahren der Replikation entwickelt werden und verfügbar sein. Erst dann existiert ein Einzeller, der einen Stoffwechsel besitzt, sich fortpflanzen kann und der Evolution unterliegt! Es ist völlig unklar, wie diese chemische Evolution funktionieren soll ...!
Die chemische Evolution von Genom und Zelle ist eine Hypothese. Sie ist bisher weder auf der Erde noch im Universum nachgewiesen. Damit liegt der qualitative Sprung von unbelebter zu belebter Materie im Dunkeln und bietet jede Menge Raum für Spekulationen. Für die Entstehung des Lebens existieren Hypothesen und Theorien, aber keine wissenschaftlichen Beweise. Das spricht nicht gegen die Evolution, denn die biologische Evolution geht davon aus, dass Leben existiert, unabhängig davon, wie es entstanden ist.
Weil die Entstehung des Lebens auf der Erde spekulativ ist, kann mit der gleichen Wahrscheinlichkeit über die extraterrestrische Entstehung des Lebens spekuliert werden. In beiden Fällen fehlen wissenschaftliche Beweise. Es ist inzwischen lediglich nachgewiesen, dass einzellige Lebewesen unter den Bedingungen des Weltraums überleben. Der Transport von Leben durch das Universum ist also prinzipiell möglich, bisher aber auch nicht wissenschaftlich exakt bewiesen.
ZITATE
Als chemische Evolution bezeichnet man eine Hypothese zur Entstehung organischer Moleküle aus anorganischen Molekülen (Abiogenese) im Hadaikum zwischen der Entstehung der Erde vor etwa 4,6 Milliarden Jahren und der Entstehung des Lebens, dem Beginn der biologischen Evolution, vor etwa 4,2 bis 3,8 Milliarden Jahren.
Aus abiotisch-anorganischen Molekülen bildeten sich demnach unter Einwirkung von Energie zunächst organische Verbindungen und präbiotische Moleküle, aus denen später erste Lebewesen hervorgingen. Vergleichbare Prozesse sind möglicherweise auch überall dort im Universum möglich, wo gemäßigte Temperaturzonen vorliegen (z. B. auf Planemos/Exoplaneten). Die Entstehung von organischen Stoffen, also von Kohlenstoff-Wasserstoff-Verbindungen, wird als Voraussetzung für die Entstehung von Lebewesen angesehen, ebenso wie z. B. das Vorhandensein gemäßigter Temperaturen, die Abwesenheit energiereicher elektromagnetischer Strahlung und die Gegenwart von Wasser als Lösungsmittel und Medium (Kosmochemie).
Quelle: http://de.wikipedia.org ...
Wird für Lebewesen das genetische Programm, seine Funktionalität und seine Entwicklung als essenziell angenommen, dann ergibt sich für den Beginn des Lebens der Zeitpunkt, zu dem Moleküle als Träger des Programms und weitere Hilfsmoleküle zur Realisierung, Vervielfältigung und Anpassung dieses Programms erstmalig zusammentreten, so dass ein System entsteht, das die charakteristischen Eigenschaften von Leben trägt.
Die derzeit populärste (autotrophe) Theorie zur Entstehung des Lebens postuliert die Entwicklung eines primitiven Metabolismus auf Eisen-Schwefel-Oberflächen unter reduzierenden Bedingungen, wie sie in der Umgebung von vulkanischen Ausdünstungen anzutreffen sind. Während dieser Phase der Evolution auf der Erde, die im geologischen Zeitraum vor zwischen 4,6 und 3,5 Milliarden Jahren stattfand, war die irdische Erdatmosphäre wahrscheinlich reich an Gasen, vor allem Kohlenstoffdioxid, Wasserstoff und Kohlenstoffmonoxid, während die heißen Ozeane relativ hohe Konzentrationen an Ionen von Übergangsmetallen wie Eisen (Fe2+) oder Nickel (Ni2+) enthielten.
Quelle: http://de.wikipedia.org ...
Im Miller-Urey-Experiment mischt man einfache chemische Substanzen einer hypothetischen frühen Erdatmosphäre – Wasser (H2O), Methan (CH4), Ammoniak (NH3), Wasserstoff (H2) und Kohlenstoffmonoxid (CO) – und setzt diese Mischung elektrischen Entladungen aus, welche die Energiezufuhr durch Gewitterblitze nachbilden sollen. Dabei entstehen nach einer gewissen Zeit organische Moleküle. Die Analyse des entstehenden Molekülgemisches wurde mittels Chromatographie durchgeführt.
Quelle:
http://de.wikipedia.org ...
Die RNA-Welt-Hypothese ist eine Theorie, die besagt, dass eine Welt mit Leben basierend auf Ribonukleinsäuren (RNA) als universeller Baustein zur Informationsspeicherung und zur Katalyse chemischer Reaktionen unseren heutigen Formen des Lebens vorausging. Sie ist ein Bindeglied zwischen den Hypothesen der chemischen Evolution, welche die Entstehung organischer Moleküle aus anorganischen Verbindungen erklären, und dem Aufkommen erster zellulärer Lebensformen. Im Rahmen der RNA-Welt-Hypothese wird angenommen, dass freie oder zellgebundene RNA im Rahmen der Evolution vom chemisch stabileren Informationsspeichermedium Desoxyribonukleinsäure (DNA) und von den funktionell flexibleren Proteinen abgelöst wurde.
Quelle: http://de.wikipedia.org ...
Die DNA einer einzelnen menschlichen Zelle ist aneinander gereiht etwa 1,80 m lang. Eine Base auf einem DNA-Strang hat theoretisch einen Informationsgehalt von 2 bit, da sie 22 = 4 Zustände (A/T/G/C) annehmen kann. Mit etwa 3 Milliarden Basenpaaren hätte das Genom des Menschen demnach einen maximal möglichen Informationsgehalt von 6 Milliarden bit oder 750 MB. Auf der Grundlage der Shannonschen Informationstheorie ergibt sich jedoch ein Informationsgehalt von maximal 50 MB, und der tatsächliche Informationsgehalt liegt wohl noch deutlich darunter, da große Teile der DNA nicht-codierende Sequenzen aufweisen, die allerdings zumindest teilweise regulatorische Funktionen haben.
Ein Vergleich der Genom-Größe mit der Komplexität und dem Organisationsgrad des Organismus ergibt keinen klaren Zusammenhang. So haben Schwanzlurche größere Genome als Reptilien, Vögel und Säugetiere. Lungenfische und Knorpelfische haben größere Genome als Knochenfische, und innerhalb von Taxa wie den Blütenpflanzen oder Protozoen variiert die Genomgröße in hohem Maß. Dies wird als „C-Wertparadoxon“ bezeichnet. Die größte DNA-Menge weisen einfache Eukaryoten wie einige Amöben sowie die Urfarne mit rund einer Billion Basenpaare auf. Diese Arten enthalten einzelne Gene als tausendfache Kopien und lange nicht-Protein-kodierende Abschnitte.
Quelle: http://de.wikipedia.org ...
Die Replikation oder Reduplikation beschreibt die Vervielfältigung des Erbinformationsträgers DNA einer Zelle nach einem semi-konservativen (von lateinisch semi „halb“;conservare „erhalten“) Prinzip. Dabei handelt es sich in der Regel um eine exakte Verdoppelung der DNA. Die Replikation wird in der Regel nur in einer bestimmten Phase des Zellzyklus angestoßen: Bei den Eukaryoten während der Synthesephase, auch S-Phase vor der Mitose, also vor einer Zellteilung. Da die genetische Verdoppelung zusammen mit der zellulären Verdopplung die Vermehrung der Prokaryoten, also aller Bakterien und Archaeen, darstellt, ist die Replikation mit der Zellteilung stark gekoppelt.
Quelle: http://de.wikipedia.org ...
Die Endosymbiontentheorie (griech. ἔνδον endo ‚innen‘ und συμβίωσις symbiōsis ‚Zusammenleben‘) besagt, dass Eukaryoten dadurch entstanden sind, dass prokaryotische Vorläuferorganismen eine Symbiose eingegangen sind. Demnach sind chemotrophe und phototrophe Bakterien von anderen prokaryotischen Zellen (möglicherweise Archaeen) durch Phagocytose aufgenommen worden und dadurch zu Endosymbionten geworden. Später haben sich die Endosymbionten zu Zellorganellen in ihren Wirtszellen entwickelt. Die Komplexe aus den Wirtszellen und den darin befindlichen Organellen sind Eukaryoten. Die Zellorganellen, die auch heute noch viele Merkmale von Prokaryoten tragen, sind Mitochondrien und Plastiden. Komplexe pflanzliche, tierische und somit auch menschliche Zellen haben damit ihren Ursprung in der Verschmelzung von Prokaryoten (vgl. Abb.). Es gibt jedoch auch Eukaryoten ohne derartige Organellen, wobei diskutiert wird, ob diese Zellbestandteile stammesgeschichtlich sekundär verloren gingen. Eukaryoten ohne solche Organellen können weder Zellatmung, noch Photosynthese betreiben.
Quelle: http://de.wikipedia.org ...
Endosymbiose ist eine sehr wahrscheinliche Theorie für die Entstehung einer eukaryotischen Zelle und mehrere derer Organellen . Sie sagt aus dass die Organellen die eine Doppelmembran und eigene DNA besitzen das sind der Zellkern (Nukleus) die Mitochondrien und in pflanzlichen Zellen die Chloroplasten prokaryotische Bakterien waren die in andere Prokaryoten einwanderten und mit ihnen eine Symbiose bildeten. Eine Membran entstammt demnach von dem Bakterium die andere von der Wirtszelle als sie dieses umschloss. Die eingewanderten Bakterien brachten auch ihre eigene DNA mit.
Quelle: www.uni-protokolle.de ...
Definition biologische Evolution
Meine Definition:
Unter biologischer Evolution versteht man die Entwicklung des Lebens auf der Erde aus einfachen zu hoch komplexen Lebewesen. Evolution bewirkt die Veränderung von Merkmalen einer Art und die Weitergabe dieser Anpassungen an die nächste Generation. Voraussetzung für die Evolution ist viel Zeit und die Vererbbarkeit von Merkmalen der Art.
Das grundlegende Ziel der Evolution ist die Anpassung der Art an ihre natürliche Umwelt. Durch die Evolution ist das Leben ein lernfähiges System.
Evolutionsfaktoren sind die Prinzipien (Mechanismen), die dafür verantwortlich sind, dass sich Merkmale einer Art verändern und vererbt werden. Wesentliche Evolutionsfaktoren sind: Mutation, Rekombination, Gendrift und Selektion.
Die synthetische Evolutionstheorie ist die Erweiterung von Darwins Evolutionstheorie durch Erkenntnisse der Molekularbiologie, Genetik, der Epigenetik und der Populationsbiologie.
Bei der evolutionären Anpassung können die Merkmale der Population so starke Veränderungen erfahren, dass neue Arten entstehen. Die Evolution wirkt permanent. Jede evolutionäre Veränderung der Art ist irreversibel und bedeutet in der Regel auch eine Zunahme der Komplexität des Individuums.
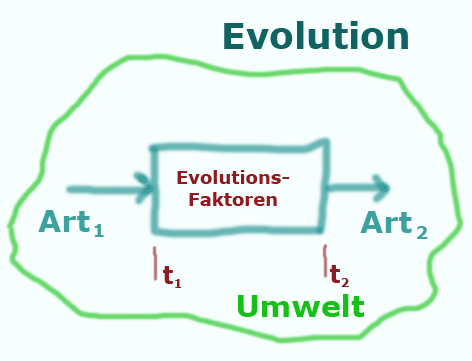 |
Bemerkungen:
- Der Begriff biologische Evolution ist zur Präzisierung erforderlich, weil "Evolution" inzwischen auch auf gesellschaftliche, technische und andere Sachverhalte angewendet wird.
- Evolution ist auf die Anpassung der Population und der Art gerichtet, nicht auf die des Individuums!
- Eine Art ist eine Population mit gleichen Merkmalen.
- Die Definition einer Art durch ihre Merkmale ist objektiv nicht möglich. Artdefinitionen sind pragmatische Vereinbarungen, auf die sich Spezialisten verständigen. Methodisch geht es dabei um Gruppen- und Rangbildung.
- Die Evolutionsfaktoren (-Prinzipien) sind die Verfahren der Evolution.
- Evolution ist ein offener, irreversibler Prozess. Evolution folgt keinem Programm, wie z.B. die Embryonalentwicklung.
- Evolution ist ein permanenter Prozess. Er ist für jeden zu beobachten. Beispiel: Grippevirus.
- Tiere und Pflanzen unterscheiden sich entscheidend durch die Energiegewinnung: Photosynthese oder nicht.
- Verfolgt man die Entstehung der Arten rückwärts, erkennt man die Entwicklung (Evolution): Höhere Lebensformen besitzen weniger entwickelte Vorfahren. Genau diese Tatsache demonstriert der Stammbaum des Lebens:
 |
Erläuterungen:
Evolution ist eine Eigenschaft des Lebens, ein Naturgesetz. Evolution ist eine Spezifik, eine Eigenschaft der lebenden Zelle. Die gesamte Erbinformation ist in der DNA gespeichert. Diese Information wird bei der Reproduktion kopiert. Aber - und das ist entscheidend - nicht 1:1 sondern mit Veränderungen. Diese Veränderungen können sinnlose, oder sogar schädliche Mutationen sein, aber auch Optimierungen von Merkmalen der Art, die eine bessere Anpassung an die Umwelt darstellen. Soweit ist die Evolution ein simpler natürlicher und sinnvoller Vorgang, der zu Anpassungen und zu neuen Arten führt. Kompliziert wird es aber sofort, wenn man nach den Verfahren fragt, die diese Evolution der Arten bewirken: Wie und wann werden bewährte Optimierungen gespeichert und weitervererbt? Die "Evolutionsfaktoren" sind hoch komplex, zufallsgesteuert und bisher wissenschaftlich nicht vollständig verstanden.
Darwin hatte Vorgänger, aber er hat als Erster das Prinzip der Evolution der Arten erkannt (1859). Er hat verstanden, dass die Arten von gemeinsamen Vorfahren abstammen und neue Arten über Zwischenformen miteinander verbunden sind. Darwins These der natürlichen Selektion hat sich als richtig herausgestellt. Die Kurzfassung - Survival of the Fittest - kennzeichnet zwar den Darwinismus, dieser Satz stammt aber von Herbert Spencer und nicht von Darwin.
Heute wird Darwins Evolutionstheorie durch die Synthetische Evolutionstheorie erweitert. Sie ist auf die Aufklärung der Evolutionsfaktoren ausgerichtet und bedient sich dafür der der Erkenntnisse der Molekularbiologie, Genetik, der Epigenetik und der Populationsbiologie.
ZITATE
Evolution: »Entwicklung«, von lat. evolvere, »entwickeln«. Bezeichnet i.e.S. die historische Entwicklung aller Lebewesen
Quelle: www.avenz.de ...
Evolution: Change in the genetic composition of a population during successive generations, as a result of natural selection acting on the genetic variation among individuals, and resulting in the development of new species.
Quelle: www.thefreedictionary.com ...
Evolution: Latin evolution-, evolutio unrolling, from evolvere
A theory that the various types of animals and plants have their origin in other preexisting types and that the distinguishable differences are due to modifications in successive generations; also : the process described by this theory
Quelle: www.merriam-webster.com ...
Evolution: The change in genetic composition of a population over successive generations, which may be caused by natural selection, inbreeding, hybridization, or mutation.
Quelle: www.biology-online.org ...
Evolution ist die Veränderung der vererbbaren Merkmale einer Population von Lebewesen von Generation zu Generation. Diese Merkmale sind in Form von Genen kodiert, die bei der Fortpflanzung kopiert und an den Nachwuchs weitergegeben werden. Durch Mutationen entstehen unterschiedliche Varianten (Allele) dieser Gene, die veränderte oder neue Merkmale verursachen können. Diese Varianten sowie Rekombinationen führen zu erblich bedingten Unterschieden (Genetische Variabilität) zwischen Individuen.
Quelle: http://de.wikipedia.org ...
Was man oft einfach als „Darwins Theorie der Evolution“ bezeichnet, beinhaltet nach Mayr (1982, S. 505ff.) tatsächlich fünf Theorien, die hier nach Futuyma (2005, S. 8) zitiert werden:
- Evolution als solche ist die schliche Aussage, daß sich die Charakteristika der Abstammungslinien einzelner Organismen mit der Zeit verändern. Diese Idee stammt nicht ursprünglich von Darwin, aber es war Darwin, der derart überzeugend die Beweise für die Evolution darstellte, daß die meisten Biologen bald akzeptierten, daß sie tatsächlich stattgefunden hatte.
- Gemeinsame Abstammung ist eine radikal unterschiedliche Sicht der Evolution als die, die Lamarck vertreten hatte… Darwin war der erste, der behauptete, daß die Arten von gemeinsamen Vorfahren abstammen und daß das gesamte Leben als ein großer Familienstammbaum dargestellt werden könne.
- Gradualismus ist Darwins Behauptung, daß sich die Unterschiede auch zwischen radikal unterschiedlichen Organismen schrittweise, durch kleine Schritte über Zwischenformen, herausgebildet haben. Die alternative Hypothese ist, daß große Unterschiede durch Sprünge, oder Saltationen, ohne Zwischenformen entstehen.
- Veränderung von Populationen ist Darwins These, daß Evolution durch Änderungen in den Verhältnissen von Individuen, die verschiedene ererbte Merkmale besitzen, innerhalb einer Population entstehen… Dieses Konzept war eine vollständig originäre Idee, die sowohl zur plötzlichen Entstehung neuer Arten durch Saltation als auch zu Lamarcks Ansatz der evolutionären Veränderung durch Transformation der Individuen im Gegensatz stand.
- Natürliche Selektion war Darwins brilliante Hypothese, unabhängig durch Wallace entwickelt, daß Veränderungen in den Verhältnissen von unterschiedlichen Typen von Individuen durch Unterschiede in ihrer Überlebens- und Reproduktionsfähigkeit verursacht werden — und daß solche Veränderungen in der Herausbildung von Anpassungen (Adaptationen) resultieren, Eigenschaften, die so aussehen, als wären sie dafür gemacht worden, Organismen an ihre Umwelt anzupassen. Das Konzept der natürlichen Selektion revolutionierte nicht nur die Biologie, sondern das abendländische Denken als ganzes.
Quelle: Till Biskup: http://www.evolutionskritik.de ...
Die Erstauflage wurde von den ursprünglich geplanten 500 auf 1250 erhöht. Am 22. November 1859 ging die vollständig vorbestellte Auflage von On the Origin of Species by Means of Natural Selection, or The Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life (Die Entstehung der Arten) an den Handel und kam am 24. November in den Verkauf. Im Buch legte Darwin im Wesentlichen fünf voneinander unabhängige Theorien dar:
- die Evolution als solche, die Veränderlichkeit der Arten;
- die gemeinsame Abstammung aller Lebewesen;
- den Gradualismus, die Änderung durch kleinste Schritte;
- Vermehrung der Arten beziehungsweise Artbildung in Populationen
- und die natürliche Selektion als wichtigsten, wenn auch nicht einzigen Mechanismus der Evolution.
Die Tatsache der Evolution wurde in den nächsten Jahren in Wissenschaftskreisen praktisch universell akzeptiert, sehr viel weniger allerdings die natürliche Selektion, mit der sich selbst Darwins Freunde Lyell und Asa Gray nicht anfreunden konnten.
Quelle: http://de.wikipedia.org ...
Biological evolution, simply put, is descent with modification. This definition encompasses small-scale evolution (changes in gene frequency in a population from one generation to the next) and large-scale evolution (the descent of different species from a common ancestor over many generations).
Quelle: http://evolution.berkeley.edu ...
Die Evolutionstheorie erklärt und beschreibt die Entstehung und Veränderung der Arten als das Ergebnis von Evolution. Die biologische Evolutionstheorie beschreibt den Stand der Forschung zu dieser Frage, wobei mehrere, sich im Detail unterscheidende Weiterentwicklungen der von Charles Darwin erstmals in seinem 1859 erschienenen Buch On the Origin of Species dargestellten Theorie der Evolution durch Natürliche Selektion bestehen. Die Unterschiede zwischen den Evolutionstheorien bestehen hauptsächlich hinsichtlich der Frage, wie sich die verschiedenen Evolutionsfaktoren in welcher Stärke auswirken und welche Evolutionsfaktoren bestimmend sind, das Prinzip der Evolution ist dagegen innerhalb der Wissenschaft unbestritten.
Quelle: http://de.wikipedia.org ...
Synthetische Evolutionstheorie: Während Charles Darwin annahm, dass die natürliche Auslese (Selektion) auf der Ebene der Art bzw. des Phänotyps wirkt, kamen im 20. Jahrhundert Modelle auf, die auf der genetischen Ebene funktionieren und zum Beispiel auch das scheinbar selbstlose Verhalten von Ameisen und Bienen erklären. In den letzten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts erkannte man, dass die Ursachen genetischer Variationen nicht nur in der DNA zu suchen sind, sondern grundlegende Prozesse auf molekularer Ebene stattfinden (Splicing). Die sehr komplex gewordene Evolutionstheorie ist längst nicht mehr eine Domäne allein der Biologen, sondern auch von Physikern und Chemikern, zumal wir inzwischen wissen, dass die Evolution auf allen Ebenen des Lebens – vom Molekül bis zum Ökosystem – unaufhörlich wirksam ist. Damit schließt sich auch der Kreis zur Entstehung des Lebens aus anorganischer Materie.
Quelle: www.dieterwunderlich.de ...
Die Synthetische Evolutionstheorie ist das Standardmodell der Evolution. Sie ist die konsistente Erweiterung der Evolutionstheorie von Charles Darwin durch vereinte Erkenntnisse der Genetik, Populationsbiologie, Paläontologie, Zoologie, Botanik und Systematik. In Darwins Werk „Die Entstehung der Arten“ fehlten diese Elemente, die erst nach seinem Tod entdeckt bzw. entwickelt wurden. Bis zur Synthese waren diese Disziplinen voneinander getrennt.
Quelle: http://de.wikipedia.org ...
Die „Synthetische Evolutionstheorie“ (im angelsächsischen Sprachraum als evolutionary synthesisbzw. modern synthesis bezeichnet) entstand in den Jahren zwischen 1930 und 1950 aus der Synthese der Darwinschen Evolutionstheorie und der (um 1900 wiederentdeckten) Mendelschen Genetik. Letztlich verhalf erst sie der natürlichen Selektion als Triebfeder der (Darwinschen) Evolution zur allgemeinen Anerkennung.
Quelle: www.evolutionskritik.de ...
Synthetische Evolutionstheorie: Sie betont die Bedeutung der Population als Einheit der Evolution und weist der Selektion eine zentrale Rolle als Mechanismus der Evolution zu. Sie erklärt wie über lange Zeiträume die Anhäufung kleiner Veränderungen einen großen Wandel bewirken kann. Sie beruht im Wesentlichen auf Darwins Gedanken, stellt aber die Population und deren Genpool ins Zentrum des Evolutionsgeschehens. Trotzdem wird sie dauernd erweitert und einzelne Fragen sind stets ungelöst. Zum Beispiel ist offen, ob die Evolution punktuell, also schubweise zu bestimmten Epochen, oder graduell, kontinuierlich in kleinen Schritten, verläuft.
Quelle: www.mindpicnic.de ...
Die Hauptaussagen der „Synthetischen Evolutionstheorie“ (im angelsächsischen Sprachraum alsevolutionary synthesis bzw. modern synthesis bezeichnet) stellen die Grundlagen der modernen Evolutionsbiologie dar. Auch wenn manche dieser Prinzipien seit den 1940er Jahren erweitert, verdeutlicht oder modifiziert wurden, werden sie von den meisten gegenwärtigen Evolutionsbiologen als grundsätzlich gültig akzeptiert.
- Der Phänotyp (beobachtete Eigenschaft) unterscheidet sich vom Genotyp (der Satz von Genen in der DNA eines Individuums); phänotypische Unterschiede zwischen einzelnen Organismen können teilweise durch genetische Unterschiede, teilweise durch direkte Einflüsse der Umwelt verursacht sein.
- Einflüsse der Umwelt auf den Phänotyp eines Individuums beeinflussen nicht die Gene, die an seine Nachkommen weitergegeben werden. In anderen Worten: Erworbene Eigenschaften werden nicht vererbt.
- Vererbbare Variationen haben ihren Ursprung in Teilchen — Genen —, die ihre Identität beibehalten, wenn sie durch die Generationen weitergegeben werden. Sie vermischen sich nicht mit anderen Genen. Das gilt sowohl für die diskret variierenden Merkmale (z.B. braune oder blaue Augen) als auch für kontinuierlich variierende Merkmale (z.B. Körpergröße oder Intensität der Pigmentierung).
- Gene mutieren, normalerweise mit einer ziemlich geringen Rate, zu gleich stabilen alternativen Formen, den Allelen. Der Effekt solcher Mutationen auf den Phänotyp kann von nicht bemerkbar bis sehr groß reichen. Die Veränderung, die durch die Mutation entsteht, wird durch die Rekombination unter Allelen an verschiedenen Loci verstärkt.
- Evolutionäre Veränderung ist ein Prozeß, der in Populationen abläuft: Sie zieht in ihrer grundlegendsten Form einen Veränderung der relativen Häufigkeiten (Proportionen oderFrequenzen) der individuellen Organismen mit unterschiedlichen Genotypen (und deshalb oft auch mit unterschiedlichen Phänotypen) innerhalb einer Population nach sich. Ein Genotyp kann schrittweise über mehrere Generationen hinweg durch andere Genotypen ersetzt werden. Dieser Austausch kann entweder nur in bestimmten oder in allen Populationen, aus denen eine Art besteht, stattfinden.
- Die Mutationsrate ist zu klein, als daß Mutation alleine eine Population von einem Genotyp zu einem anderen verschieben könnte. Stattdessen kann die Veränderung der Verhältnisse der Genotypen innerhalb einer Population durch einen von zwei grundlegenden Prozessen stattfinden: Zufällige Fluktuationen in den Verhältnissen (genetische Drift) oder nichtzufällige Veränderungen durch die Überlegenheit eines Genotyps hinsichtlich Überleben und/oder Fortpflanzung im Vergleich zu anderen (d.i. natürliche Selektion). Natürliche Selektion und genetische Drift können gleichzeitig am Werke sein.
- Auch eine geringe Intensität der natürlichen Selektion kann (unter gewissen Umständen) zu entscheidenden evolutionären Veränderungen in einem realistischen Zeitfenster führen. Natürliche Selektion kann sowohl kleine als auch große Unterschiede zwischen Arten erklären, als auch die frühesten Stadien der Entwicklung neuer Merkmale. Adaptionen sind Merkmale, die durch die natürliche Selektion geformt wurden.
- Die natürliche Selektion kann die Populationen über den ursprünglichen Bereich ihrer Variation hinaus verändern, indem sie die Frequenz von Allelen erhöht, die durch Rekombination mit anderen Genen, die dieselben Merkmale beeinflussen, neue Phänotypen hervorbringen.
- Natürliche Populationen sind genetisch variabel und können so oft schnell evolvieren, wenn sich die Umweltbedingungen verändern.
- Populationen einer Art in unterschiedlichen geographischen Regionen unterscheiden sich in den Merkmalen, die eine genetische Grundlage haben.
- Die Unterschiede zwischen unterschiedlichen Arten, und zwischen unterschiedlichen Populationen derselben Art, liegen oft in den Unterschieden von wenigen oder vielen Genen begründet, von denen viele einen kleinen Einfluß auf den Phänotyp haben. Dieses Muster stützt die Hypothese, daß kleine Unterschiede zwischen Arten durch eher kleine Schritte evolvieren.
- Unterschiede zwischen geographischen Populationen einer Art sind oft adaptiv und daher das Ergebnis der natürlichen Selektion.
- Phänotypisch unterschiedliche Genotypen finden sich oft in einer einzelnen untereinander kreuzenden Population. Arten werden nicht einfach anhand phänotypischer Unterschiede definiert. Vielmehr repräsentieren unterschiedliche Arten verschiedene „Genpools“. Das bedeutet, daß Arten Gruppen (potentiell) untereinander kreuzender Individuen sind, die keine Gene mit anderen solchen Gruppen austauschen.
- Artentstehung (Speziation) ist der Ursprung einer oder mehrerer Arten von einem gemeinsamen Vorfahren. Speziation wird normalerweise durch die genetische Differenzierung geographisch getrennter Populationen hervorgerufen. Aufgrund der geographischen Trennung werden die beginnenden genetischen Unterschiede nicht länger durch Kreuzung verhindert.
- Unter den lebenden Organismen gibt es viele Abstufungen in phänotypischen Merkmalen zwischen Arten, die derselben Gattung, unterschiedlichen Gattungen und unterschiedlichen Familien oder höheren Taxa zugeordnet werden. Solche Beobachtungen erbringen den Nachweis, daß höhere Taxa durch die anhaltende, schrittweise Anhäufung kleiner Unterschiede entstehen anstatt durch das plötzliche Auftreten grundlegend neuer „Typen“.
- Die fossilen Funde weisen jede Menge Lücken zwischen ziemlich unterschiedlichen Arten von Organismen auf. Solche Lücken können durch die Unvollständigkeit der fossilen Funde erklärt werden. Aber die fossilen Funde enthalten ebenfalls Beispiele von Übergängen von offensichtlichen Vorläuferorganismen zu ziemlich unterschiedlichen Nachfolgern. Diese Daten unterstützen die Hypothese, daß die Evolution großer Unterschiede schrittweise erfolgt. Folglich scheint es möglich, die Prinzipien, die die Evolution von Populationen und Arten erklären, auch auf die Evolution höherer Taxa auszuweiten.
Aus Futuyma: Evolution. Sinauer, Sunderland 2005, S. 10f. Übersetzung durch den Autor dieser Seiten.
Quelle: Till Biskup: www.evolutionskritik.de ...
Die Geschichte der Evolutionstheorie beginnt bereits in der Antike und reicht über Charles Darwin (1809–1882) bis in die Gegenwart. Darwins Theorie und ihre Nachfolger sind nicht nur eine Evolutionstheorie, sondern zugleich eine Abstammungstheorie.
Quelle: http://de.wikipedia.org ...
Evolutionsfaktoren = Verfahren der Evolution
Meine Definition:
Evolutionsfaktoren sind die Verfahren der Evolution. Es sind die Prinzipien (Mechanismen), die dafür verantwortlich sind, dass sich Erbinformation verändern und bei der Reproduktion vererbt und an die nächste Generation weitergegeben werden.
Die wesentlichen Evolutionsfaktoren sind Selektion, Mutation, Rekombination und Gendrift.
Evolutionsfaktoren im weiteren Sinne sind auch Migration, Genfluss, Isolation, Horizontaler und Vertikaler Gentransfer und Hybridisierung.
Durch epigenetische Prozesse reagiert die Evolution auch auf kurzfristige Umweltveränderungen.
Bemerkungen:
- Auf die Vererbungslehre (Genetik) wird hier nicht eingegangen, ohne sie funktioniert aber Evolution nicht!
- Die hier genannten Evolutionsverfahren sind mit Sicherheit unvollständig, weil noch nicht erkannt und verstanden.
- Die Evolutionsfaktoren sind zufallsgesteuert.
- Auch die "Spielregeln" der Evolution sind willkürlich gesetzt.
- Viele Evolutionsfaktoren und der Zufall machen das Evolutionsergebnis nicht vorhersehbar.
- Starke Umweltveränderungen erzeugen einen hohen Selektionsdruck.
- Möglicherweise hat jede Art ihre spezifische Evolutionsgeschwindigkeit (Vergleich zwischen Viren und Insekten).
- Regional unterschiedliche Umweltbedingungen führen zu der sehr grossen Vielfalt des Lebens.
- Die Verbesserung der Anpassung führt in der Regel auch zu einer Erhöhung der Komplexität.
- Es entstehen nicht nur neue Arten, es sterben auch welche aus:
Wenn sich beispielsweise die Umwelt zu schnell ändert. - Survival of the Fittest heisst: Am besten an die Umwelt angepasst: Nicht am schnellsten, grössten, schönsten ...
- Ziel der Selektion ist weder nützlich noch perfekt, sondern besser als der Konkurrent.
- Selektion ist ein qualitativer Sprung: Vererbung, Ja oder Nein.
- Der Evolutionsprozess ist kontinuierlich, jedes Merkmal, jede Funktion besitzt einen Vorgänger/Vorfahren.
- Es existieren grössere genetische Sprünge, aber sie sind selten. Ursache: Mutation und zufällig auf Anhieb gut.
- Neuheiten entstehen durch Neuentstehung und Funktionswechsel (Das Auge wurde 40 x neu erfunden!)
- Epigenetik kann auch als Kurzzeit-Evolution angesehen werden: Das Epigenom reagiert auf äußere Einflüsse.
- Die Funktion des Epigenoms und seine Bedeutung sind noch wenig verstanden.
- Mutationen sind blind, die Evolution nicht!
Erläuterungen:
Mutation:
Durch Mutationen wird der Genpool eines Lebewesens (Phänotyp) zufällig und ungerichtet, aber dauerhaft verändert. Die meisten Mutationen führen zu Schädigungen (Behinderungen) bei dem betroffenen Individuum, da die Wahrscheinlichkeit, durch eine Mutation eine Verbesserung in einem ganzen Organismus zu erzielen, sehr gering ist.
Rekombination:
Unter Rekombination werden die zufällige und ungerichtete Veränderung der Verteilung und/oder die Anordnung von Teilen der DNA verstanden. Es handelt sich um einen Austausch von Allelen. Ein Allel kennzeichnet Struktur und Relationen eines einzelnen Gens auf einem Chromosom. Durch Rekombination wird die genetische Variabilität erhöht. Rekombination ist nur bei geschlechtlicher Vermehrung möglich. Durch Rekombination entstandene Individuen sind in der Regel lebensfähig.
Gendrift:
Gendrift bezeichnet die zufällige Veränderung der Position der Gene auf einem Chromosom. Sie tritt beispielsweise nach Naturkatastrophen auf, bei der die meisten Individuen einer (kleinen) Population nicht überlebt haben. Gendrift und Genshift führen zur Verringerung der genetischen Vielfalt!
Genshift:
Genshift ist eine massive Gendrift: Komplette Gensegmente werden zufällig ausgetauscht. Genshift hat deshalb oft qualitative Änderungen der Population zur Folge. Gendrift kommt oft in kleinen Populationen vor. (Gründereffekt)
Genfluss:
Austausch der Gene zwischen Gruppen von Individuen einer Art, die vorher getrennt gelebt haben. Dieser Genfluss, beispielsweise verursacht durch Migration, führt zu Veränderungen im Genpool beider Teilpopulationen.
Gentransfer:
Als Gentransfer wird die Übertragung von Genen von einem Organismus auf einen anderen bezeichnet. Man unterscheidet zwischen horizontalem Gentransfer (Ungeschlechtlicher Fortpflanzung über Artgrenzen hinweg: Besonders bei Mikroorganismen) und vertikalem Gentransfer (Geschlechtlicher Fortpflanzung, z.B. durch Kreuzung).
Migration:
Migration bedeutet die Zu- und Abwanderung von Individuen verschiedener Populationen einer Art und ihre Vermischung. Dadurch wird der Genfluss ermöglicht. Der Genpool beider Populationen wird durch die Vermischung egalisiert.
Isolation:
Die Isolation einer Population verursacht Genveränderungen gegenüber anderen Populationen der gleichen Art. Die Isolation kann räumlich (Beispiel: Insellage) erfolgen, ist aber auch ökologisch möglich (Beispiel: Ökologische Nische). Weitere Isolationsformen sind die zeitliche, ethologische oder die mechanische usw. Isolation.
Hybridisierung:
Ein Hybrid wird ein Individuum genannt, das aus der Kreuzung zwischen Eltern verschiedener Arten oder Unterarten entstanden ist. Da es Eigenschaften beider Eltern besitzt, können durch Hybridisierung leicht neue Unterarten oder Arten entstehen.
Epigenetik:
Das Genom ist nicht starr, sondern es verhält sich dynamisch und steuert die vielen Teilfunktionen einer Zelle. Die Epigenetik untersucht diese Steuerungsprozesse, die durch Genaktivitäten erfolgen. Das Epigenom ist nicht in der DNA-Sequenz festgelegt, stellt aber 90 Prozent des menschlichen Genoms dar! Das Epigenom ist durch äussere Einflüsse wesentlich leichter zu beeinflussen, als die Gene. Auch diese epigenetischen Veränderungen können vererbt werden.
Selektion:
Durch Selektion werden die Anpassungen "bewertet", die durch die anderen Evolutionsverfahren hervorgerufen wurden. Selektion ist ein Entscheidungsprozess: Die Anpassung, die sich in der Umwelt bewährt hat, wird vererbt. Damit sind die Individuen der nachfolgenden Generationen besser angepasst, als ihre Vorfahren. Ohne Selektion keine Evolution!
Selektion bewirkt eine gerichtete Verschiebung der Häufigkeit bestimmter Allele im Genpool. Man unterscheidet die transformierende, die stabilisierende und die aufspaltende Selektion. Einfluss auf die Selektion besitzen abiotische Faktoren (Klima, Geografie, Wasserqualität, Industrialisierung ...) und biotische Faktoren (Nahrungsangebot, Feinde, Krankheiten ...).
Als Selektionsdruck wird die Intensität der abiotischen und der biotischen Faktoren auf eine Population bezeichnet. Hoher Selektionsdruck = hohe Evolutionsrate = hohe Selektionsnotwendigkeit.
ZITATE
Die Evolution wendet bei ihrer Suche drei Grundprinzipien an. Diese sind die Mutation, die
Rekombination und die Selektion. Alle Prinzipien unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Funktion und Wichtigkeit für den Evolutionsprozess.
Die Mutation ist ein ungerichteter Suchprozess. Sie erzeugt Varianten und Alternativen. Dies
ist besonders wichtig, um lokale Optima zu überwinden. Die Wahrscheinlichkeit einer Mutation ist jedoch sehr gering.
Sehr viel häufiger finden Rekombinationen statt. Rekombination (engl. crossing over) genannt, bezeichnet den Austausch von langen Nucleotidketten zwischen den homologen Chromosomen der Eltern. Der Sinn dieses Verfahrens besteht darin, bereits bewährte Genkombinationen neu zu mischen, um eine Verbesserung in Richtung des Optimums zu erreichen.
Das wohl wichtigste Prinzip der Evolution ist die Selektion. Sie bestimmt im Wesentlichen
die Richtung, in der sich die Evolution bewegt. Die Selektion wäre ein deterministischer Vorgang. Jedoch machen Störungen, z.B. zufällige Unglücke einzelner Individuen, oder Umweltkatastrophen, die den Lebensraum ganzer Populationen verändern, sowie Rückkopplungseffekte zwischen Lebewesen und Umwelt, aus der Selektion einen nicht-deterministischen
Vorgang.
Quelle: www.tu-chemnitz.de ...
Als Evolutionsfaktor bezeichnet man in der Biologie Prozesse, durch die der Genpool – das ist die Gesamtheit aller Genvariationen in einer Population – verändert wird. Eine exakte Definition des Begriffs liefert die Populationsgenetik: Evolutionsfaktoren sind Prozesse, die zu Veränderungen der Allelfrequenzen im Genpool einer Population führen oder Allele auf den Chromosomen neu kombinieren. Nach der Synthetischen Evolutionstheorie sind diese Prozesse Ursache aller evolutionären Veränderungen.
Die wesentlichen Evolutionsfaktoren sind Rekombination, Mutation, Selektion und Gendrift.
Evolutionsfaktoren im weiteren Sinne sind auch Migration, Genfluss, Isolation, Horizontaler und Vertikaler Gentransfer und Hybridisierung.
Quelle: http://de.wikipedia.org ...
Der Gesamtbestand dieser Erbinformationen wird als Genpool der Population bezeichnet. Die verschiedenen Allele (verschiedene Basensequenzen codieren ein Gen) treten dabei unterschiedlich oft auf. Dies wird als Allelfrequenz genannt.
Die fünf Evolutionsfaktoren bewirken die Variabilität (Verschiedenheit) der Allelfrequenzen: Mutation,
Rekombination,
Selektion,
Gendrift und
Isolation.
Quelle: http://schwarzwurzel.sc.funpic.de ...
Als Punktmutation wird in der Biologie eine Genmutation bezeichnet, wenn durch die Veränderung nur eine einzelne Nukleinbase betroffen ist. Sie ist damit als ein Spezialfall der Genmutation und damit auch der strukturellen Chromosomenaberration zu betrachten.
Quelle: http://de.wikipedia.org ...
Epigenetik: Die Epigenetik beschäftigt sich mit den Mechanismen, die diese Genaktivität in der Zelle steuern. Dabei werden einzelne Gene und/oder Genabschnitte an- und abgeschaltet, ohne dass sich die Abfolge der DNA ändert. Es entstehen übergeordnete, nicht in der Gensequenz festgelegte Expressionsmuster, die von Zellen zu Tochterzellen weitergegeben sowie von Elterngenerationen auf die Nachkommen vererbt werden können. ... Zu den wichtigsten epigenetischen Regulationsmechanismen zählen die Methylierung der DNA, die RNA Interferenz und die Modifikation der Histone.
Quelle: www.biosicherheit.de ...
Epigenetik: Epigenetische Marker stecken nicht in den Buchstaben der DNS selbst, sondern auf ihr: Es sind chemische Anhängsel, die entlang des Doppel-Helix-Strangs oder auf dem "Verpackungsmaterial" der DNS verteilt sind. Sie wirken als Schalter, die Gene an- und ausknipsen. In den vergangenen Jahren haben Epigenetiker große Fortschritte im Verständnis dieser übergeordneten Steuermechanismen erzielt. Dabei wurde immer klarer, dass das Epigenom für die Entwicklung eines gesunden Organismus ebenso wichtig ist wie die DNS selbst. Deutlich wurde bei den Forschungen auch, dass das Epigenom durch äußere Einflüsse weit leichter als die Gene verändert werden kann. Die größte Überraschung aber ist: Epigenetische Signale werden von den Eltern an die Kinder weitergegeben.
Quelle: www.geo.de ...
Epigenetik: Sie befasst sich mit Zelleigenschaften (Phänotyp), die auf Tochterzellen vererbt werden und nicht in der DNA-Sequenz (dem Genotyp) festgelegt sind. Dabei erfolgen Veränderungen an den Chromosomen, wodurch Abschnitte oder ganze Chromosomen in ihrer Aktivität beeinflusst werden. Man spricht infolgedessen auch von epigenetischer Veränderung bzw. epigenetischer Prägung. Die DNA-Sequenz wird dabei jedoch nicht verändert. Das kann sowohl durch eine DNA-Methylierung als auch durch eine Modifikation der Histone erfolgen.
Quelle: http://de.wikipedia.org ...
Facit
und ...
Offene Fragen zu Evolution
Biologische Evolution ist ein sehr komplexes Forschungsfeld. Deshalb macht es Mühe, sich in die wissenschaftlich sehr anspruchsvolle Materie einzulesen. Auf der anderen Seite aber ist Evolution auch ein sehr klares Naturgesetz: Lebewesen lernen sich an ihre natürliche Umwelt anzupassen und sind in der Lage, diese Erfahrungen an ihre Nachkommen zu vererben. Was ist daran kompliziert oder unglaublich? Das Leben ist lernfähig - Das ist plausibel und sinnvoll. Evolution hat überhaupt nichts mit Mystik zu tun, und ein Creator wird dazu auch nicht gebraucht.
Schwierig wird es nur, sobald man ins Detail geht. Dann zeigt sich sofort die Komplexität des Evolutionsprozesses und seiner Evolutionsfaktoren mit praktisch unendlich vielen Stellschrauben, die alle Einfluss auf das Endergebnis nehmen. Viele Fragen sind heute wissenschaftlich zu beantworten, aber nicht alle.
Hier ist eine Liste solcher offenen Fragen. Ein paar davon wird man beantworten können, wenn die Forschung weiter fortgeschritten ist. Einige der Fragen aber werden nie zu beantworten sein. Aus dem einfachen Grund, weil die Welt für Menschen nicht erkennbar ist (auch wenn der Marxismus das immer noch behauptet). Diese Tatsache spricht aber nicht für Allah, Jesus, Amun Re oder Shiva, sondern viel eher für Kant. Die Menschen und ihre Götter sind viel zu beschränkt, um die Komplexität ihrer Umwelt zu begreifen. Viel weniger noch sind sie in der Lage, das Wesen dieses Universums zu erfassen.
Ungeklärte Fragen:
- Wie erfolgte der qualitative Sprung von unbelebter zu belebter Materie auf der Erde?
- Evolution ist eine Eigenschaft des Lebens, ein Naturgesetz. Wie bei allen Naturgesetzen
sind die Regeln willkürlich gesetzt. Warum? - Ist auch eine Evolution vorstellbar, die zielgerichtet und ohne Zufall wirkt?
- Ist Leben ohne Evolution vorstellbar?
- Gibt es Bereiche im Universum, wo andere Evolutionsfaktoren (Regeln) wirken?
- Wie wird sich der Mensch evolutionär weiterentwickeln?
- Gentechnik ist heute nur Manipulation vorhandenen Lebens. Wird die Codierung des Genoms einmal so verstanden sein, dass höheres Leben chemisch synthetisiert werden kann?
- Was ist Leben ausser Fortpflanzung und möglichst grosser Verbreitung der Genome?
- Was ist der Mensch? Siehe beispielsweise: Natürliche Automaten
- Warum hat es auf der Erde nur einmal einen Start des Lebens gegeben. Warum startet das Leben nicht permanent neu?
- Warum ist zu verschiedenen Zeiten die Evolutionsgeschwindigkeit unterschiedlich hoch?
Warum gibt es Schübe? Kann allein der Selektionsdruck die Kambrische Explosion erklären? - Warum entwickelt sich nicht eine spezielle Art (z.B. in der Flora) so effektiv, dass sie alle anderen Arten auffrisst, ausrottet und als alleinige Art die Weltherrschaft antritt?
- Wie funktioniert die Selektionsentscheidung: Nach welchen Kriterien wird entschieden, was eine gute Anpassung ist, die vererbt wird?
- Jede qualitativ neue Funktion ist ein Sprung. Z.B.: Infrarotsensor, ja oder nein. Was initiiert den Qualitätssprung?
- Welche Vorformen fehlen, die darauf schliessen lassen, dass Sprünge im Evolutionsprozess existieren?
- Das Fortpflanzungsverfahren über die Zellteilung (Replikation der DNA) ist extrem stabil.
Tausendfüßer gibt es beispielsweise schon seit rund 410 Millionen Jahren. Wie wird diese Stabilität erreicht? - Beinhaltet das Verfahren der Evolution auch das Aussterben des gesamten Lebens oder ist es unendlich?
Noch ein paar interessante Links zu Evolution
Evolutionskritik www.evolutionskritik.de ...
Der Gorilla im Menschen www.sueddeutsche.de ...
Nachdenken über Evolution www.bertramkoehler.de ...
Schlüsselerfindungen der Evolution www.thur.de ...
Begriffs-Lexikon Evolution www.blackwellpublishing.com ...
Wie sich das Epigenom organisiert www.spiegel.de ...
Lehrer in Tennessee dürfen Evolution anzweifeln www.spiegel.de ...
Leben geht auch anders: XNA www.dradio.de ...
Kommentar Al: Vorsicht: Bei der XNA wird (wie bei der gesamten Gentechnik)
wieder das "vernachlässigbar kleine" Restrisiko unterschätzt. 23.04.2012
Nach dem Hype der Gen-Analysen www.heise.de ...
Gene unterwegs -Horizontaler Gentransfer www.dradio.de ...
Wissenschaft contra Kreationismus:
Evolutionskritiker bezweifeln,
dass evolutionär, zufällig und ohne Konstrukteur ein Motor entstehen kann.
Der Geißelmotor eines Spermiums, Bild aus: www.apologeticspress.org ...
 |
Die wissenschaftliche Erklärung:
Motorproteine sind eine von fünf Funktionsgruppen
der Cytoskelettproteine ... http://de.wikipedia.org ...
Hier noch ein solcher Grenzfall bei dem man sich fragt, wie die Evolution das macht:
 |